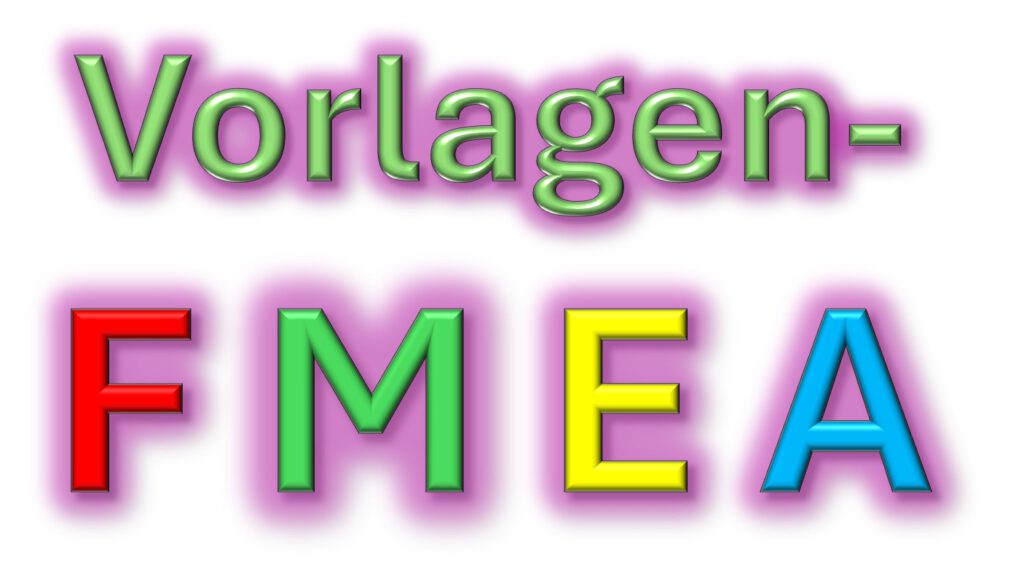
Vorlagen-FMEAs
Ein Beitrag von Dr. Uwe-Klaus Jarosch, Juli 2025
Die Fehler-Möglichkeiten und Einfluss-Analyse (FMEA) wird als valide Methode eingesetzt, um in der Produkt- und Prozessentwicklung eine Risiko-Analyse durchzuführen.
Die Erstellung einer solchen FMEA ist mit nicht unerheblichem Aufwand verbunden.
Wenn ein ähnliches Produkt oder ein vergleichbarer Prozessschritt analysiert wird, so möchte man nicht wieder bei Null beginnen und das Rad neu erfinden.
Die Idee ist daher, bestehende FMEAs zu verwenden und den Aufwand im neuen Projekt zu reduzieren.
Übertragbarkeit
Nur die Tatsache, dass es schon ein Dokument mit der Überschrift FMEA gibt, heißt nicht, dass daraus für das Folgeprojekt sinnvolle Übertragungen möglich sind.
Die erste Überlegung ist, die FMEA des Vorgängerprojektes zu nutzen.
Wir erstellen eine Kopie und passen das für das neue Projekt an.
An dieser Stelle ist eine wesentliche Frage, was die FMEA im Projekt erfüllen soll: Entwicklungsunterstützung oder Pflichtübung?
Ist die FMEA eine Pflichtübung um formale Anforderungen an eine Dokumentation zu erfüllen, dann ist es ein totes Dokument, das nur gezogen wird, wenn der Staatsanwalt eine Produkthaftungsklage verfolgt. Also in extrem seltenen Ausnahmefällen. “Das ist bei uns noch nie vorgekommen.”
Wenn es doch passiert, kann man als Unternehmen nur hoffen, dass zumindest die Struktur und Dokumentation einigermaßen aussagekräftig ist. Üblicherweise kann man den Inhalt so entstandener FMEAs nicht belasten.
Ist die FMEA als Entwicklungsunterstützung entstanden, dann werden auch fachlich relevante Themen behandelt sein. Das Folgeprojekt wird Inhalte des Vorgängers nutzen, aber auf die Unterschiede und Neuheiten eingehen. Die galt es ja neu zu entwickeln, zu erproben und freizugeben.
Bei sauberer Dokumentation steht dann auch in der neuen FMEA, dass die FMEA mit der Nummer xy als Basis genutzt wurde.
Was macht den Unterschied zwischen den Projekten aus?
Falls wir über ähnliche Produkte reden, über Produkte aus einer Produktfamilie oder über die spezifische Anwendung eines üblichen Prozesses, so werden die Kernfunktionen identisch sein.
Die Abtriebswelle soll bei vorgegebener Länge und Anschlussflansch ein Drehmoment übertragen. Als Anforderungen für diese Funktion sind das maximale Gewicht, die Nenndrehzahl und die maximal zulässige Unwucht vorgegeben.
Daraus lassen sich Designmerkmale wie Hohlstab oder Vollstab, Durchmesser, Zentrizität, Materialeigenschaften, etc. als “Designkompromiss” festlegen.
Ähnlich wird in der Fertigungsfolge ein Standard-Drehprozess angewendet, um den Übergang zwischen Stab und Flansch nach Zeichnung zu fertigen. Durchmesser, Radien und Oberflächengüte mit ihren Toleranzen sind die Zielgrößen. Drehzahl, Vorschub, der gewählte Drehmeißel und die Spanntechnik sind die zugehörigen Prozessparameter.
Für ein “einfaches” Produkt, für einen einzelnen Arbeitsschritt in der Fertigung ist das überschaubar und gut darstellbar.
Mit zunehmender Strukturgröße ( = mehr Einzelteile, mehr Schnittstellen, mehr Unter-Prozesschritte) werden sowohl die Anzahl der Funktionen, als auch die Nebenbedingungenn = Anforderungen zahlreicher und lassen die Unterschiede rasant anwachsen. Eine Vergleichbarkeit wird zunehmend schwierig.
Außerdem kommen die Probleme im neuen Projekt nur dann zutage, wenn wir über konkrete Ziele in den Funktionen und Anforderungen, über konkrete Merkmale mit konkreten Toleranzen sprechen können. Die Aufgabe liegt nicht in der Entwicklung des Prinzips, sondern in der Detailgestaltung für diesen Fall. Also liegen auch alle Ursachen möglicher Probleme in den Details.
Mit zunehmender Strukturgröße wird die Übertragbarkeit immer schwieriger.
Vorlagen aus kleinen Einheiten
Daher liegt ein Lösungsansatz darin, kleinere Einheiten zu standardisieren und nach Bedarf für das neue Projekt “zusammenzusetzen”.
Wenn das Produkt aus einer Art Baukasten entsteht oder der Prozess sich aus zahlreichen Basisschritten aufbauen lässt, so sind Vorlagen für diese kleineren Einheiten sinnvoll und sparen Zeit bei der FMEA-Erstellung im Folgeprojekt.
Eine Herausforderung für jedes Unternehmen ist, diese kleinen Einheiten zu ermitteln, sie mit einer Priorität für die Erstellung der dafür nötigen FMEA zu versehen und die Inhalte dann mitFachleuten erstellen zu lassen.
Dies wird Zeit = Aufwand = Geld benötigen und muss als Investition des Unternehmens in Know How betrachtet werden.
Diese Investition wird sich dann auszahlen, wenn im Unternehmen eine Reihe begleitender Maßnahmen erfolgt sind:
Was ist bei uns eine Vorlage-FMEA?
Die erste begleitene Maßnahme ist eine Regel, ein Standard, eine Festlegung.
Was ist bei uns im Unternehmen eine Vorlage – FMEA?
- Wie soll sie benannt werden?
- Was muss sie genau oder mindestens enthalten?
- Wer muss dabei mitwirken?
- Womit muss der Inhalt abgeglichen sein?
- Wann und wie soll diese Vorlage genutzt werden?
Dies betrifft Themenwahl, Umfang, Betrachtungstiefe, Anzahl von Sprachen in international tätigen Unternehmen, Festlegung und Unterscheidung von Muss vs. Kann, Kennzeichnung von Lessons Learned, Aktualisierungsdienst und nicht zuletzt die Autorisierung als freigebene, verbindliche Vorlage.
Freigabe-Prozess für Vorlagen-FMEAs
Üblicherweise gibt es im technischen Umfeld Normen, öffentliche Richtlinien, aber auch Unternehmens-Standards und “Best Practice”-Vorgehensweisen. Dies kann in Schriften, in Dateien, in Datenbanken oder in Köpfen von Experten vorliegen. Die Vorlagen-FMEAs sollten unbedingt widerspruchsfrei zu diesem Wissen sein und den aktuellen Stand der “Best Practice” wiedergeben.
Meine Empfehlung ist, dass die Erstellung solcher Vorlagen drei Fraktionen im Unternehmen beteiligt:
- die fachliche Vertretung für diesen Inhalt. Das sind die Experten, die “Center of Competence”, die Meister oder Entwicklungsleiter:innen.
- die FMEA-Moderatoren, die den Experten helfen, ihr Wissen in die Struktur der FMEA zu übertragen und
- die Methoden-Experten, die projektunabhängig bewerten können, ob Puzzleteile für ein zusammengesetztes Produkt oder eine Prozessfolge methodisch korrekt erstellt wurden.
Vererbung von Vorlagen-FMEAs
Einige FMEA-Programme verfügen über eine Verknüpfung von Inhalten zwischen FMEAs als Vererbung.
Im Unterschied zu einer Kopie wird bei der Vererbung eine dauerhafte Vater-Kind-Beziehung hergestellt.
Woher kommt der Inhalt?
Wo wurde die Vorlage überall verwendet?
Die Nutzung einer Vorlage muss zwingend erlauben, Änderungen vorzunehmen. Schließlich ist das Projekt immer anders als die Vorlage.
Aber Themen, wie Muss-Kann bei Lösungswegen = Maßnahmen sollten sich dann aus der Vorlage in das Projekt eindeutig überführen lassen.
Auch ein Standard ist nicht unantastbar. Aber die Entscheidung, vom Standard abzuweichen muss ggf. mit dem Eigner des Standards abgestimmt werden.
Für die Planung von Schweißanlagen ist die Nutzung bestimmter Roboter, Schweißbrenner und Steuergeräte als Unternehmensstandard vorgeschrieben. Will das Projekt davon abweichen, so ist die Genehmigung des Schweiß-Anlagen-CoC einzuholen.
Gibt es die Wahl zwischen drei Alternativen, so steht es dem Projekt frei, die optimale Alternative zu entscheiden.
In einem vererbenden System ist sowohl nachvollziehbar, welche Inhalte wo genutzt werden, als auch wer die Teammitglieder von Vorlage und Projekt-FMEA sind.
Wird die Vorlage aktualisiert, so kann die neue Information gezielt an das Dokument und damit an die Personen weitergegeben werden. Dies ist nach meiner Erfahrung ein idealer Weg für “Lessons Learned” .
Umgekehrt können die Projekt-Mitarbeitenden in der FMEA finden, welche Experten die Vorlagen erstellt haben und Informationen Bottom-Up weiterleiten, die z.B. aus der Bearbeitung einer Reklamation eingepflegt wurden und jetzt an andere, ähnlich gelagerte Fälle weitergegeben werden sollen.
Das CoC kann solche Vorschläge zu einer neuen Variante oder gar zu einer neuen verpflichtenden Maßnahme machen. Durch erneute Freigabe der Vorlage-FMEA geht dann die Information an alle derzeitigen Anwender.
Der LL-Kreislauf ist geschlossen.
Fazits:
- Vorlagen sind eine (erhebliche) Investition.
- Vorlagen lohnen sich, wenn sie gezielt genutzt werden.
- Lieber kleine als große Bausteine.
- Autorisierung der Inhalte und Verbindlichkeit in der Anwendung sind zwingend.
- Vererbung von FMEA-Wissen kann zu einem geschlossenen Lessons-Learned-Zyklus führen.
Es will gut bedacht sein.
Bleibe neugierig.
Uwe Jarosch